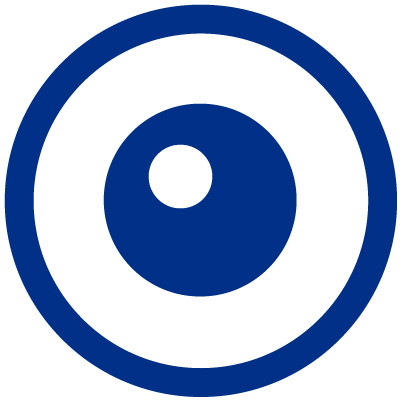Worum geht es bei der Entscheidung?
Geklagt hat hier der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die Deutsche Bahn AG (DB). Stein des Anstoßes war die bisherige Praxis der DB mit ihren sogenannten Spar- und Supersparpreistickets. So gab die DB die vorgenannten vergünstigten Ticketarten von Oktober 2023 bis Dezember 2024 ausschließlich digital heraus. Als Kunde musste man zwingend eine Handynummer oder E-Mail-Adresse angeben, um das digitale Ticket beziehungsweise die Auftragsnummer zu empfangen. Diese Praxis war über die Bahn-App, am Schalter oder telefonisch über den Reiseservice die gleiche. An ihr stößt sich der klagende vzbv und begehrt klageweise deren Unterlassung.
Welche Positionen vertreten die Parteien?
Die DB ist hier der Ansicht, dass die vorgenannte Praxis dem Kundeninteresse diene. Kundinnen und Kunden haben ja gerade ein Interesse an günstigen Fahrpreisen. Diese könnten vor allem mit einer beschleunigten Vertragsabwicklung erreicht werden. Der technische Fortschritt der Digitalisierung sei ein wichtiges Instrument, um diese Beschleunigung zu erreichen.
Der vzbv hält diese Äußerungen der DB für wenig zielführend und bloße Schutzbehauptungen. Seiner Ansicht nach liege hier ein eklatanter Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor, da die verpflichtende Weitergabe von Daten der Kundinnen und Kunden nicht dem eigentlichen Vertragszweck des Beförderungsvertrags, sondern ausschließlich Unternehmensinteressen diene.
Der letzten Ansicht hat sich auch das OLG angeschlossen und die streitgegenständliche Praxis für rechtswidrig erklärt.
„Der Senat stellte klar, dass die Verarbeitung der Kontaktdaten weder auf einer wirksamen Einwilligung noch auf einer anderen Rechtsgrundlage der DS-GVO beruhte. Die Verbraucherinnen und Verbraucher könnten keine freie Entscheidung über die Preisgabe ihrer Daten treffen, da sie keine "echte oder freie Wahl" gehabt hätten. Wer nicht bereit gewesen sei, eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu nennen, habe das Ticket einfach nicht erwerben können. Gegen die Freiwilligkeit spreche auch die marktbeherrschende Stellung der Deutschen Bahn Fernverkehr AG auf dem Markt des Eisenbahnfernverkehrs. Auf einen Konkurrenten auszuweichen, sei meist nicht möglich.
Das Ticket selbst diene lediglich dem Nachweis der Bezahlung des Beförderungsvertrags. Dafür könnten Privatpersonen nicht gezwungen werden, ihre Daten preiszugeben. Die digitale Form des Tickets erleichtere allein der Deutschen Bahn die Abwicklung der Hauptleistung und diene vornehmlich unternehmensinternen Zwecken wie der Kundenbindung, Werbung oder der Kontrolle des Nutzerverhaltens. Das OLG stellte zudem fest, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auch nicht zur Verwirklichung überwiegender berechtigter Interessen unbedingt erforderlich war. Bloße Nützlichkeit oder bestmögliche Effizienz genügten dafür nicht.“ (Zitat: rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/olg-ffm-6ukl1424-deutsche-bahn-sparpreise-tickets-datenschutz-fahrgaesteÖffnet sich in einem neuen Fenster)
Ist die Sache höchstrichterlich entschieden?
Hier hat das OLG erstinstanzlich entschieden. Die Entscheidung ist jedoch nicht anfechtbar. Es ist ohnehin seit einigen Monaten nicht mehr davon auszugehen, dass die DB gegen diese Entscheidung weiter Schritte unternehmen würde, da sie ihre Vertragspraxis seit Januar diesen Jahres den Vorstellungen des vzbv entsprechend angepasst hat.
Wie wirkt sich das Urteil am Ende auf die Verbraucher aus?
Verbraucherinnen und Verbraucher können sich sicher sein, dass die DB die Vergabe ihrer Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets zukünftig nicht mehr davon abhängig machen darf, dass Kundinnen und Kunden ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse freiwillig zur Verfügung stellen. Nach diesem Urteil muss auch eine Ticketvergabe unproblematisch analog möglich sein.
Ist die Entscheidung gut?
Ja, Daumen uneingeschränkt nach oben. Hier entscheidet das OLG meines Erachtens völlig zutreffend und stärkt Kundinnen und Kunden den Rücken. Unter dem Deckmantel des technischen Fortschritts darf ihnen nicht die Preisgabe bestimmter Daten abverlangt werden. Zumal die Daten bei der eigentlichen Durchführung des Beförderungsvertrages keine zwingende Notwendigkeit besitzen. Die DB darf als Quasi-Monopolist nicht Maßnahmen, die nur ihren eigenen Interessen dienen (Stichwort Kundenbindung), auf die Schultern aller Kundinnen und Kunden abwälzen.
Was kann der Verbraucher jetzt machen?
Hier zunächst die gute Nachricht: Die DB hat ihr Verhalten aufgrund dieses Verfahrens bereits geändert, so dass in Zukunft auch Spar- und Supersparpreistickets analog und ohne die Preisgabe vorgenannter Daten erhältlich sein müssten. „Der Drops ist insofern gelutscht“, wie es so schön heißt.
Allerdings sollten Verbraucherinnen und Verbraucher die Erkenntnisse aus diesem Urteil auch auf andere Vertragssituationen übertragen. Immer dort, wo ein Monopolist oder Quasi-Monopolist Vertragspartner ist und die Vertragsdurchführung von der Preisgabe bestimmter Daten abhängig macht, sollten sie hellhörig werden, ihre Daten nicht Preis geben und die Verbraucherzentrale vor Ort kontaktieren, damit von dort aus Maßnahmen getroffen werden, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten (zum Beispiel Abmahnung, Unterlassungsklage).
Wo ist das Urteil zu finden?
Das Urteil des OLG Frankfurt vom 10.07.25 hat das Aktenzeichen Az 6 UKl 14/24
Stand: Juli 2025