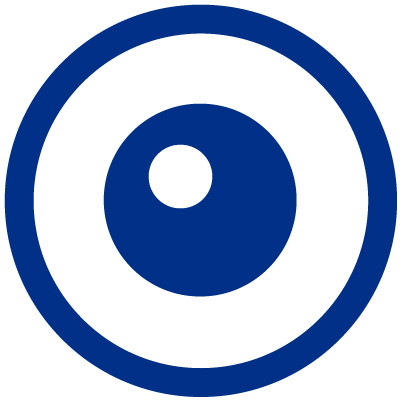Worum geht es bei der Entscheidung?
Im vorliegenden Fall klagt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die Firma Sony, die unter anderem Play-Station-Plus-Abonnements vertreibt. Stein des Anstoßes sind vor allem zwei Klauseln in den Abonnement-Bedingungen der Beklagten. Hierin behält sich Sony zum einen vor, die Abo-Preise einseitig erhöhen und zum anderen die Anzahl der angebotenen Online-Spiele einseitig einschränken zu können. Der vzbv wendet sich klageweise gegen die Geltung dieser Abonnement-Bedingungen.
Welche Positionen vertreten die Parteien?
Der klagende vzbv hält die Klausel, die Sony zu einer einseitigen Preiserhöhung berechtigt für eine unangemessene Benachteiligung der Verbraucher und damit für rechtswidrig. Die Beklagte habe schon kein berechtigtes Interesse, eine solche Klausel zu verwenden. Da der streitgegenständliche Vertrag von beiden Seiten auch kurzfristig gekündigt werden könne, wäre im Falle einer außergewöhnlichen Kostensteigerung der Weg über eine Vertragskündigung und neuem Vertragsabschluss zu den geänderten Konditionen zu beschreiten. Dieser „neue“ Vertrag müsse dann noch vom Verbraucher angenommen werden. Die dann notwendige Zustimmung könne bei jedem „neuen“ Nutzen des Abos eingeholt werden. Die Klausel sei außerdem unzulässig, weil sie Tür und Tor für unkontrollierbare Preiserhöhungen öffne. Außerdem sehe sie als Pendant zu Preiserhöhungen keine Pflicht zu Preissenkungen bei gesunkenen Kosten vor.
Die zweite strittige Klausel, in der sich Sony vorbehalten hatte, die Anzahl und Verfügbarkeit der im Abonnement enthaltenen Spiele und Online-Funktionen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ist laut vzbv ebenfalls rechtswidrig. Eine derart weitgefasste Änderungsbefugnis der vereinbarten Leistungen sei den Abonnentinnen und Abonnenten nicht zumutbar. Man müsse spätestens bei Vertragsschluss erkennen können, welche Vertragsänderungen gegebenenfalls auf einen zukommen könnten.
Sony ist der Ansicht, dass man sich mit den beiden vorgenannten Klauseln lediglich für unvorhergesehene Ereignisse vorbereite beziehungsweise absichere. Gerade die jüngste Zeit (zum nBeispiel Coronakrise, Ukrainekrieg) habe gezeigt, dass unvorhergesehene Ereignisse auch kurzfristig einen erheblichen Einfluss auf die Kostenstruktur von Unternehmen haben können und ein kurzfristiges Einschreiten der Unternehmerseite erforderlich machen. Dies diene auch der Verbraucherseite, denn nur so könne das Leistungsangebot ohne empfindliche Einschränkungen aufrechterhalten werden.
Der ersten Ansicht hat sich auch das Kammergericht (KG) hier angeschlossen und die beiden streitgegenständlichen Klauseln in den Abonnement-Bedingungen der Beklagten für rechtswidrig erklärt.
Ist die Sache höchstrichterlich entschieden?
Hier hat das Kammergericht (KG) Berlin in der Berufungsinstanz entschieden. Die Revision zum BGH wurde explizit nicht zugelassen, weil das KG Berlin die Voraussetzungen des § 542 Abs. 2 ZPO nicht für gegeben erachtet. Sony hat jedoch Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH (Bundesgerichtshof) eingelegt. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass der BGH die Beschwerde für begründet hält und noch einmal im Revisionsverfahren über die Sache urteilen wird. Diese Erwartungshaltung gründet auf der Tatsache, dass gegen Spotify und Netflix ganz ähnliche Urteile ergangen sind.
Wie wirkt sich das Urteil am Ende auf die Verbraucher aus?
Dieses Urteil hat zunächst einmal eine ganz praktische Auswirkung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sony darf nicht mehr, legitimiert durch zwei Vertragsklauseln die Preise für ihr Playstation-Plus-Abonnement willkürlich erhöhen und im Abonnement enthaltenen Spiele und Online-Funktionen willkürlich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.
Ist die Entscheidung gut?
Ja, Daumen uneingeschränkt nach oben. Dieses Urteil erinnert einmal mehr an die Gleichwertigkeit der Vertragsparteien, Sony auf der einen Seite und die Abonnentinnen beziehungsweise Abonnenten auf der anderen Seite. Die wesentlichen Vertragsbestandteile, die sogenannten essentialia negotii (wie es im Juristenjargon heißt) wie zum Beispiel Vertragspreis und Vertragsgegenstand bedürfen zwingend notwendig der Zustimmung „beider“ Vertragsparteien. In Abonnementbedingungen kann so etwas nicht geregelt werden und schon gar nicht einseitig. Sehr gut, dass das Kammergericht Sony an dieses Einmaleins des Vertragsrechts erinnert.
Was kann der Verbraucher jetzt machen?
Dieses Urteil gegen Sony erinnert stark an bereits gegen Netflix und Spotify ergangene Urteile. Auch hier wurde in den klauselartigen Nutzungsbedingungen versucht, wesentliche Vertragsbestandteile flexibel zu regeln. Man kann Verbraucherinnen und Verbrauchern nur dringend ans Herz legen, vor Vertragsschluss die Geschäftsbedingen, die eventuell etwas kleiner gedruckt und angehängt sind, unter die Lupe zu nehmen und auf negative Überraschungen oder „Fallstricke“ hin zu überprüfen. Sollte man mit den Bedingungen nicht einverstanden sein oder sollten einem negative Überraschungen begegnen, so sollte der Vertrag nicht abgeschlossen werden. Dann wäre unmittelbar die Verbraucherzentrale vor Ort zu kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Wo ist das Urteil zu finden?
Das Urteil des KG Berlin vom 30.10.24 hat das Aktenzeichen 23 MK 1/23.
Stand: Januar 2025