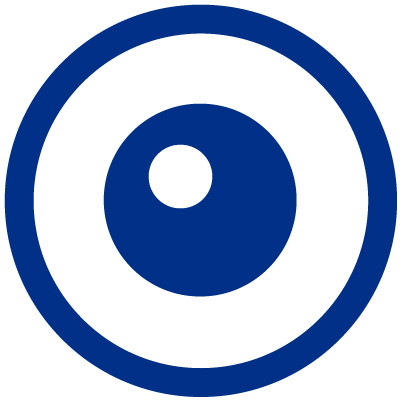Worum geht es bei der Entscheidung?
Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist ein Rechtsstreit, der vor einem österreichischen Gericht anhängig war. Ein Mobilfunkanbieter verwehrte einer Kundin einen Mobilfunkvertrag unter Hinweis auf deren „festgestellte“ fehlende Bonität. Eine sogenannte Bonitätsbeurteilung wurde von einem Spezialisten hierfür, der Firma Dun & Bradstreet Austria, mittels eines automatisierten Scoring-Verfahrens durchgeführt. Hiergegen wendete sich die Frau, begehrte mehr Informationen darüber, welche Aspekte bei diesem automatisierten Verfahren wie gewichtet wurden und machte unter anderem einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geltend. Mittels rechtskräftiger Entscheidung bekam die Frau Recht. Das für die Vollstreckung dieser Entscheidung zuständige Gericht setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, welche konkreten Maßnahmen Dun & Bradstreet in diesem Zusammenhang ergreifen müsse und wie die DSGVO und die Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen in diesem Zusammenhang auszulegen seien.
Welche Positionen vertreten die Parteien?
Es findet hier keine Einlassung der Parteien zur Sache statt, sondern nur Ausführungen des EuGH zur oben aufgeworfenen Rechtsfrage:
Für den EuGH sei klar, dass der Verantwortliche das Scoring-Verfahren und dessen zugrundeliegenden Grundsätze so erklären müsse, dass man nachvollziehen könne, welche personenbezogenen Daten im Rahmen des automatisierten Scoring-Verfahrens auf welche Art verwendet würden. Transparent und nachvollziehbar könnte es bereits sein, wenn die betroffene Person darüber informiert würde, in welchem Maße eine Abweichung bei den berücksichtigten personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Ergebnis geführt hätte. Die bloße Übermittlung eines Algorithmus erfülle dieses Transparenz- und Nachvollziehbarkeitserfordernis hingegen nicht. „Sei der Verantwortliche der Ansicht, die Übermittlung dieser Informationen beträfen geschützte Daten Dritter oder auch Geschäftsgeheimnisse der Auskunftei selbst, habe er diese vermeintlich geschützten Informationen der zuständigen Aufsichtsbehörde oder dem zuständigen Gericht zur Prüfung zu übermitteln. Daneben stellt der Gerichtshof klar, dass die DSGVO der Anwendung nationaler Bestimmungen entgegenstehe, die dieses Auskunftsrecht grundsätzlich ausschließen, wenn die Auskunft ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis des Verantwortlichen gefährden würde.“ (vzbv aaO)
Ist die Sache höchstrichterlich entschieden?
Hier hat der Europäische Gerichtshof (EuGH), das höchste europäische Gericht in Zivilsachen, entschieden. Alle Gerichte der Mitgliedsstaaten müssen nun im Lichte dieses Urteils der Luxemburger Richter entscheiden. Es wird keine weitere Entscheidung in dieser Sache mehr geben.
Wie wirkt sich das Urteil am Ende auf die Verbraucher aus?
Dieses Urteil hat zunächst einmal eine ganz praktische Auswirkung. Die einzelnen Prüfschritte bei automatisierten Bonitätsprüfungen (Scoring-Verfahren) müssen für Betroffene stets transparent und nachvollziehbar sein. Somit werden sie in die Lage versetzt, die Prüfung nachvollziehen und gegebenenfalls anfechten zu können. Die bloße Mitteilung eines Prüfergebnisses genügt diesen Anforderungen jedenfalls nicht.
Ist die Entscheidung gut?
Ja, Daumen uneingeschränkt nach oben. Dieses Urteil zeigt einmal mehr die Schwachstellen von Endergebnissen auf, die durch automatisierte Verfahren erzielt werden: Wenn diese nicht näher erklärt werden, sind sie intransparent und nicht nachvollziehbar. Der EuGH hat sich hier ja nicht grundsätzlich gegen automatisierte Bonitätsprüfungen entschieden. Dennoch müssen diese den Betroffenen so transparent erklärt werden, dass sie nachvollziehbar und gegebenenfalls anfechtbar sind.
Was kann der Verbraucher jetzt machen?
Man sollte sich mit einem mitgeteilten negativen Ergebnis von automatisierten Bonitätsprüfungen nicht abfinden. Nach diesem Urteil ist das Prüfverfahren (Scoring-Verfahren) näher zu erläutern. Auf die Mitteilung einer solchen Erklärung sollte man bestehen. Nach Prüfung der Erklärung sollte man das Scoring-Verfahren gegebenenfalls anfechten.
Wo ist das Urteil zu finden?
Das Urteil des EuGH vom 27.02.2025 hat das Aktenzeichen Az. C-203/22.