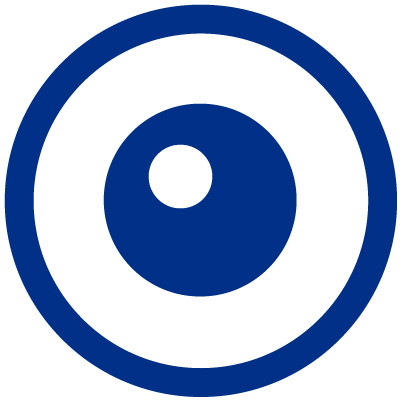Was ist das Metabolische Syndrom?
Unter dem Begriff „Metabolisches Syndrom“ werden verschiedene Risikofaktoren zusammengefasst, die oft gemeinsam auftreten und das Risiko für Typ-2-Diabetes und für Herz- und Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöhen. Zu den Risikofaktoren zählen neben Übergewicht und Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Zucker- und Fettstoffwechselstörungen. Da deren Ursachen nicht nur genetisch- oder altersbedingt sind, sondern vor allem in einer mangelnden körperlichen Aktivität und einer ungesunden Ernährung begründet sein können, ist ein gesunder Lebensstil das beste Mittel zur Prävention.
Zahlen, Daten, Fakten
Deutschlandweit haben etwa 20 Prozent der Menschen ein Metabolisches Syndrom, also circa 16,6 Millionen Personen. Im Alter ist der Anteil etwas höher. Unter den 50- bis 70-Jährigen leiden etwa 40 Prozent darunter. Männer erkranken insgesamt etwas häufiger als Frauen.
Die fünf Risikofaktoren eines Metabolischen Syndroms
Charakteristisch für das Metabolische Syndrom sind fünf Risikofaktoren, von denen mindestens drei Faktoren vorliegen müssen, damit die Diagnose gestellt wird:
- Starkes Übergewicht (Adipositas)
Besonders eine abdominale Adipositas, also starkes Übergewicht, das sich vor allem im Bauchraum und um die Körpermitte zeigt, der sogenannte „Apfel“-Typ, ist gesundheitlich bedenklich. Das liegt daran, dass dieses Fettgewebe besonders stoffwechselaktiv ist. Bei der Diagnose wird daher neben dem Body-Mass-IndexÖffnet sich in einem neuen Fenster auch der Taillenumfang ermittelt. Eine bauchbetonte Adipositas liegt laut der Deutschen Adipositas Gesellschaft e.V. bei Frauen ab einem Taillenumfang von 88 und bei Männern ab einem Taillenumfang von 102 Zentimetern vor.
- Bluthochdruck (Hypertonie)
Von einem erhöhten Blutdruck spricht man ab einem Blutdruck von 130 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) (systolisch) und/oder 85 mmHg (diastolisch). Bedienungsfreundliche Messgeräte erlauben heute, dass der Blutdruck einfach, schnell und zuverlässig auch eigenständig zu Hause kontrolliert werden kann. Bei Bluthochdruck empfiehlt sich jedoch die regelmäßige Kontrolle bei der Hausärztin oder dem Hausarzt.
- Erhöhte Blutzuckerwerte
Der Blutzucker wird in der Regel im nüchternen Zustand gemessen, damit beispielsweise ein süßes Frühstück nicht zu falschen Diagnosen führt. Von erhöhten Werten spricht man ab einem Blutzuckerwert von 100 Milligramm pro Deziliter. Ist der Blutzucker dauerhaft erhöht, kann eine Glucose-Intoleranz die Ursache sein, bei der der Körper den Blutzuckerspiegel nicht mehr richtig regulieren kann. Es besteht das Risiko eines Typ-2-Diabetes.
- Erhöhte Blutfettwerte
Zu den Blutfetten zählen neben den Triglyceriden, das Gesamtcholesterin, das HDL- und das LDL-Cholesterin. Triglyceride bestehen aus Glycerin und insgesamt drei Fettsäuren, sie dienen der Energiespeicherung des Körpers. Ab einem Wert von 150 Milligramm pro Deziliter spricht man von erhöhten Triglycerid-Werten.
Cholesterin ist für den Körper von zentraler Bedeutung. Es ist ein wichtiger Baustoff, Bestandteil der Zellen und dient zur Herstellung von Hormonen und Vitamin D. Das Gesamtcholesterin im Blut ist ab Werten von 200 Milligramm pro Deziliter erhöht und kann Hinweise auf mögliche Fettstoffwechselstörungen geben. Zusammen mit anderen Blutfettwerten kann der Cholesterinwert zudem helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzuschätzen. Es setzt sich aus dem HDL- und dem LDL-Cholesterin zusammen. Hohe LDL-Cholesterin-Werte sind mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, weshalb es auch das „schlechte Cholesterin“ genannt wird. Von erhöhten LDL-Werten spricht man ab 130 Milligramm pro Deziliter.
- Niedrige HDL-Cholesterinwerte
Das sogenannte HDL-Cholesterin wird als „gutes Cholesterin“ bezeichnet, weil es mit eher günstigen Effekten auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht wird. Zu niedrig sind die Werte für das HDL-Cholesterin im Blut für Frauen unter 50 und für Männer unter 40 Milligramm pro Deziliter.
Man geht davon aus, dass alle diese Risikofaktoren des Metabolischen Syndroms pathophysiologisch miteinander verknüpft sind, also in einem Zusammenhang oder in Wechselwirkung zueinander stehen im Hinblick auf krankhafte Prozesse im Körper.
Folgen
Neben dem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall, kann sich aus dem Metabolischen Syndrom auch ein Typ-2-Diabetes entwickeln. Auch eine Metabolismus-assoziierte Fettleber Öffnet sich in einem neuen Fensterentsteht häufig durch oder zusammen mit einem Metabolischen Syndrom. Gleichzeitig kann diese wiederum Ursache oder Folge eines Diabetes sein.
Einen gesunden Lebensstil anstreben
In manchen Fällen sind Medikamente erforderlich, um die Risikofaktoren eines Metabolischen Syndroms wie Bluthochdruck oder einen erhöhten Blutzucker zu behandeln. Gleichzeitig kann eine gesunde Lebensweise einem Metabolischen Syndrom vorbeugen und sie spielt auch eine entscheidende Rolle bei seiner Behandlung.
Neben ausreichend Bewegung und körperlicher Aktivität, unterstützen eine ausgewogene Ernährung, ein maßvoller Umgang mit Alkohol und Nikotinverzicht ein gesundes Körpergewicht, eine Normalisierung des Blutdrucks und gesunde Blutfettwerte. Insbesondere bei Bluthochdruck können eine Rauchentwöhnung und die Verwendung von weniger Salz beim Würzen der Speisen helfen.
Ausgewogen essen und auf das Gewicht achten
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) zeigt mit ihren DGE-Empfehlungen „Gut essen und trinken“ einen Weg zu einer ausgewogenen und gesundheitsförderlichen Ernährung:
• Am besten Wasser trinken
• Obst und Gemüse – viel und bunt
• Hülsenfrüchte und Nüsse regelmäßig essen
• Vollkorn ist die beste Wahl
• Pflanzliche Öle bevorzugen
• Milch und Milchprodukte jeden Tag
• Fisch jede Woche
• Fleisch und Wurst – weniger ist mehr
• Süßes, Salziges und Fettiges – besser stehen lassen
• Mahlzeiten genießen
• In Bewegung bleiben und auf das Gewicht achten
Ernährung und körperliche Aktivität können vorbeugend und auch begleitend eine wichtige Rolle zur Prävention oder Behandlung eines Metabolischen Syndroms und seiner Risikofaktoren spielen. Gleichzeitig kann sie im Bedarfsfall keine Medikation oder andere Therapieformen ersetzen, weshalb in jedem Fall stets ärztlicher Rat eingeholt werden sollte. (Kup)