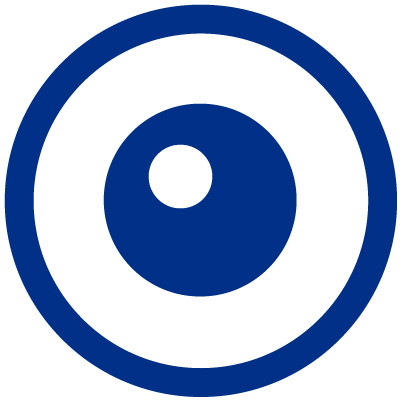Die Funktion der Leber
Die Leber ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Sie nimmt Nährstoffe auf, speichert oder verstoffwechselt diese und baut Gifte ab wie zum Beispiel Schadstoffe oder Abfallprodukte, die beim Abbau von Medikamenten oder bei der Verdauung entstehen. Daneben reguliert sie auch den Fett- und Zuckerstoffwechsel sowie den Haushalt von Mineralstoffen, Vitaminen und Hormonen.
Eine wichtige Funktion der Leber ist außerdem die Produktion der Galle. Die Galle ist eine Flüssigkeit, die in der Gallenblase gespeichert wird und für die Fettverdauung und die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K von Bedeutung ist.
Überschüssige Energie wird gespeichert
Wird dem Körper zu viel Energie zugeführt, speichert er die überschüssige Energie ab. Überschüssiges Fett, das mit der Nahrung aufgenommen wurde, wird beispielsweise zu Fettsäuren, den kleinsten Bestandteilen der Fette, abgebaut und in Form von Triglyceriden in den Fettdepots des Körpers gespeichert. Auch aus Eiweißen kann die Leber Fettsäuren herstellen, die im Fettgewebe oder in den Leberzellen gespeichert werden. Kohlenhydrate baut der Körper zu einfachen Zuckerbausteinen, der Glucose, ab. Ein Teil der Glucose kann in der Leber und in den Muskeln in ihrer Speicherform Glykogen gelagert werden. Braucht der Körper Energie, wird das Glykogen dann wieder freigesetzt.
Übergewicht und Fettleber
Eine zu hohe Energieaufnahme und zu wenig Bewegung können zu einer Gewichtszunahme und langfristig zu Übergewicht führen. Übergewicht kann nicht nur eine verminderte körperliche Leistungsfähigkeit, Schäden am Bewegungsapparat oder Krankheiten wie Diabetes, koronare Herzkrankheiten oder Bluthochdruck begünstigen, sondern ist auch eine der Hauptursachen für die Entstehung einer Fettleber.
Metabolismus-assoziierte Fettleber
Die Metabolismus-assoziierte Fettleber (MASLD) (ehemals nicht-alkoholische Fettleber) und eine Leberentzündung im Rahmen einer Leberverfettung (Steatohepatitis) zählen zu den häufigsten Lebererkrankungen auf der Welt. Die MASLD kann zunächst zu einer Leberentzündung und nachfolgend zu einer Leberzirrhose voranschreiten, sodass die Leberfunktionen beeinträchtigt werden und das Risiko für Krebserkrankungen der Leber steigt.
Häufigste Ursachen für die Metabolismus-assoziierte Fettleber sind Übergewicht, Adipositas, Fettstoffwechselstörungen und Insulinresistenz, die durch eine Fehl- und Überernährung hervorgerufen werden.
Um das Risiko für eine Fettleber zu verringern, sollte daher ein gesundes Körpergewicht angestrebt werden.
Ausgewogen essen und auf das Gewicht achten
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) zeigt mit ihren DGE-Empfehlungen „Gut essen und trinken“Öffnet sich in einem neuen Fenster einen Weg zu einer ausgewogenen und gesundheitsförderlichen Ernährung:
- Am besten Wasser trinken
- Obst und Gemüse – viel und bunt
- Hülsenfrüchte und Nüsse regelmäßig essen
- Vollkorn ist die beste Wahl
- Pflanzliche Öle bevorzugen
- Milch und Milchprodukte jeden Tag
- Fisch jede Woche
- Fleisch und Wurst – weniger ist mehr
- Süßes, Salziges und Fettiges – besser stehen lassen
- Mahlzeiten genießen
- In Bewegung bleiben und auf das Gewicht achten
Wird zum Erreichen eines gesunden Körpergewichts eine Gewichtsreduktion angestrebt, sollte diese langsam und nicht schlagartig erfolgen (circa 250-500 Gramm pro Woche).
Ballaststoffe und ausreichend Flüssigkeit
Die Aufnahme von mindestens 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag wird mit einem geringeren Risiko für unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Adipositas und Bluthochdruck in Verbindung gebracht und senkt somit auch das Risiko für eine Metabolismus-assoziierte Fettleber. Die Empfehlungen der DGE berücksichtigen den Verzehr ballaststoffreicher Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, Vollkornprodukte, Gemüse und Obst.
Da die Leber neben der Niere auch zahlreiche Entgiftungsfunktionen übernimmt, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. Diese unterstützt die Ausscheidung von Giftstoffen über den Urin. Geeignete Durstlöscher sind Mineralwasser, verdünnte Saftschorlen, ungesüßte Früchtetees sowie (in Maßen) Kräutertees.
Cholesterin
Der Körper reguliert den Cholesterinspiegel durch die Produktion körpereigenen Cholesterins in Leber und Darm. Daher wird der Blutcholesterinspiegel weniger von dem Cholesterin über die Ernährung als durch die Art und Menge der Nahrungsfette insgesamt beeinflusst. Eine ungünstige fettreiche Ernährung kann zu erhöhten Cholesterin- und Blutfettwerten führen. Sie kann Ursache oder Folge einer Fettlebererkrankung sein.
Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung sollte die Aufnahme gesättigter Fettsäuren (zum Beispiel in Fleisch, Schokolade, Butter) und trans-Fettsäuren (zum Beispiel in frittierten Produkten, Backwaren, Süßwaren, Fertigprodukten) reduziert werden. Gleichzeitig sollte die Aufnahme mehrfach ungesättigter Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren (zum Beispiel in fettreichem Seefisch, pflanzlichen Ölen, Nüssen) erhöht werden.
Daneben unterstützen weitere Lebensstilfaktoren wie ein Nikotinverzicht sowie ausreichend Sport einen günstigen Cholesterinspiegel im Blut.
Eiweiß – Nicht zu viel, nicht zu wenig
Die Leber reguliert den Stoffwechsel der Aminosäuren, den kleinsten Bausteinen der Eiweiße. Zum einen baut sie Eiweiße aus Aminosäuren auf, zum anderen baut sie Abbauprodukte der Eiweißverdauung aus dem Darm um, sodass diese als Harnstoff über die Niere ausgeschieden werden können.
Bei langfristig zu geringer Zufuhr von Eiweißen ist die Fähigkeit der Leber verringert, Gifte und Stoffwechselprodukte auszuscheiden und unter anderem wird das Immunsystem geschwächt. Wird dauerhaft zu viel Eiweiß aufgenommen, belastet das die Leber.
Ein gesunder Erwachsener zwischen 19 und 64 Jahren sollte täglich 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Bei einem Körpergewicht von 75 Kilogramm wären das 60 Gramm Eiweiß. Ein Glas Milch (200 Milliliter) enthält zum Beispiel zehn Gramm Eiweiß.
Alkoholische Fettleber
Wird übermäßig und chronisch Alkohol konsumiert, steigt das Risiko für die Entwicklung einer alkoholischen Fettleber (AFL). Aus ihr können ähnlich wie bei der Metabolismus-assoziierten Fettleber Leberentzündungen, eine Leberzirrhose und Leberkrebs resultieren.
Ein zu hoher Alkoholkonsum kann die Leber zu stark beanspruchen. In der Folge kann diese ihre Entgiftungs- und Stoffwechselfunktionen nicht mehr erfüllen. Abbauprodukte des Alkohols wie Acetaldehyd können die Leberzellen schädigen und es kann zu einer vermehrten Fetteinlagerung, der alkoholischen Fettleber, kommen.
Alkoholkonsum erhöht das Risiko für viele Krankheiten
Für den Körper ist Alkohol ein Zellgift, das nahezu alle Körperzellen und somit auch Organe schädigen kann. Neben Erkrankungen der Leber können auch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Krebs, Übergewicht, Schädigungen des Gehirns sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen mit einem erhöhten Alkoholkonsum einhergehen.
Die DGE ist ziemlich rigoros, wenn es um Alkoholkonsum geht und empfiehlt, auf alkoholische Getränke zu verzichten.
Bei einer bereits bestehenden Lebererkrankung sollte Alkohol streng gemieden und aufgrund des noch möglichen Restalkoholgehalts auch auf mit „alkoholfrei“ deklarierte Getränke sowie auf alkoholhaltige Desserts und Süßigkeiten verzichtet werden.
Liegt eine alkoholische Fettleber vor, kann diese durch eine Alkoholabstinenz wieder ausheilen und sich regenerieren. (Kup)
Stand: Juli 2025